Debattenkompass Wert & Wirkung

Mit Wert & Wirkung bieten wir einen wissenschaftlich fundierten Kompass für die Debatten unserer Zeit an. Diesmal erklären wir, warum Normalität kein Maßstab ist und wie wir es schaffen, aus dem Status quo auszubrechen.
Was wir gewohnt sind, erscheint uns normal. Der tägliche Stau auf dem Weg zur Arbeit, die Currywurst im Stadion, das neue Paar Sneaker, das wir morgens bestellen und noch am selben Abend in der Hand halten – all das ist für uns selbstverständlich. Aber ist es deshalb auch richtig?
Die Transformationsforschung sagt: Nein. Denn Normalität ist keine objektive Gegebenheit, sondern ein soziales Konstrukt. Was wir als normal beschreiben, ist geprägt durch unsere Erfahrungen in der sozialen Welt. Normal ist das, was sich durch gesellschaftliche Wiederholung stabilisiert hat – und das lässt sich verändern.
Gerade deshalb ist es wichtig, gelegentlich einen Schritt zurückzutreten und den Status quo zu hinterfragen: Was beschreiben wir als Normalität – und was blenden wir dabei aus? Denn wer die Gegenwart nicht regelmäßig hinterfragt, läuft Gefahr, Möglichkeitsräume zu übersehen. Dann wird aus einem weiten Horizont schnell ein enger Tunnel – in dem es scheinbar „keine Alternative“ gibt.
Transformation durch Design oder Desaster?
Das birgt Risiken. Wenn wir an überholten Routinen festhalten, statt Wandel bewusst zu gestalten, droht im schlimmsten Fall der Zusammenbruch – was die Forschung als „transformation by disaster“ bezeichnet. Oder aber die Schäden nehmen schleichend zu: Hitze, Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfälle, politische Instabilität – all das sind mögliche Folgen einer verspäteten Reaktion. Die Folge: Immer häufiger muss eingegriffen werden, etwa mithilfe von Notstandsmaßnahmen. In der spanischen Urlaubsregion Katalonien wurde zum Beispiel im Februar 2024 aufgrund von anhaltender Dürre der Wassernotstand ausgerufen, sodass der Wasserverbrauch drastisch begrenzt werden musste, was insbesondere Landwirte hart traf.
Besser ist die „transformation by design“ – also ein bewusst gestalteter Übergang hin zu resilienten, nachhaltigen Systemen. Doch wie gelingt das?
Die Hebelpunkte des Systems nutzen
Die Umweltwissenschaftlerin Donella Meadows hat dafür ein hilfreiches Modell entwickelt: die Hebelpunkte (“leverage points”) in Systemen: Je tiefer ein Eingriff ansetzt, desto wirksamer ist er. Technische Optimierungen und neue Anreize sind zwar oberflächlich wirksam, reichen aber allein noch nicht aus, um Veränderungen auszulösen. Wichtig ist, auch die tiefer liegenden Regeln eines Systems anzugehen – oder noch fundamentaler: die übergeordneten Ziele und Weltbilder, die unser Handeln leiten. Wenn wir diese Grundannahmen verändern, öffnen sich ganz neue Möglichkeitsräume.
Was als sinnvoll, legitim oder möglich gilt, bestimmen sogenannte Paradigmen. Werden sie verändert, wandelt sich das ganze System. Denken wir etwa die Natur nicht mehr als Ressourcenkammer, die man einfach ausplündern kann, sondern als lebendiges Netzwerk mit eigenem Wert, zeigen sich die Schattenseiten unserer derzeitigen, “normalen” gesellschaftlichen Praktiken – und wir müssen umdenken. Solche Paradigmenwechsel sind zwar schwierig herbeizuführen, doch wenn es gelingt, können sie soziale Kipppunkte auslösen – beschleunigende Effekte gesellschaftlicher Veränderung (mehr dazu in unserem Debattenkompass zu sozialen Kipppunkten).
Doch wie verändert sich ein Paradigma? Laut Meadows sind drei Schritte wesentlich dabei:
- Die Widersprüche des alten Denkens sichtbar machen.
- Aus der Perspektive des neuen Paradigmas sprechen und handeln
- Gesellschaftliche Unterstützung aufbauen, etwa über Menschen in Schlüsselpositionen
Mehr als nur Geldwerte: Wie wir echten Fortschritt messen
Paradigmen drücken sich auch darin aus, wie wir Fortschritt messen. Noch immer dominiert das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, die wirtschaftspolitische Debatte. Doch diese aggregierte Zahl von Geldwerten greift zu kurz. Selbst das World Economic Forum empfiehlt in seinem Bericht The Future of Growth zusätzliche Indikatoren wie Innovationskraft, Teilhabe, ökologische Nachhaltigkeit und Resilienz, um Fortschritt wirklich effektiv zu beschreiben und zu messen. Neben dem BIP werden von 107 Ländern daher auch Daten zu Bildung, Biodiversität, sozialer Gerechtigkeit oder demokratischer Stabilität gesammelt.
Denn Wandel braucht beides: den Mut, Gewohntes zu hinterfragen – und die Fantasie, sich eine andere Zukunft vorzustellen.
Ein solcher Rahmen liegt längst vor: Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) verbinden soziale, ökologische und wirtschaftliche Ziele. Doch der jährliche Europe Sustainable Development Report zeigt: Seit 2015 gibt es in vielen EU-Ländern kaum Fortschritte. Damit sich das ändert, braucht es ein ganzheitliches Politikverständnis – eines, das Ressortgrenzen überwindet und Wirkung in den Mittelpunkt rückt. Dafür sollten etwa die Nachhaltigkeitsziele in Haushaltsentscheidungen integriert werden und die Wirkung von Maßnahmen über Legislaturperioden hinweg betrachtet werden. Konkret bedeutet das, dass wir Fortschritt und Erfolg weniger an Umfragewerten, sondern vielmehr an der Zielerreichung messen würden. Um diesen Ansatz in der Politik zu implementieren, gibt es konkrete Vorschläge – von Ombudspersonen für zukünftige Generationen bis hin zu einer Stärkung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung.

Wie könnte die Zukunft aussehen, wenn wir mutig wären und anfingen, Gewohntes zu hinterfragen? Bild: NEWS&ART /Visualisierung: Reinventing Society & Wire Collective & German Zero
Soziale Kipppunkte: Wandel beginnt im Alltag
Auch jenseits der Politik kann jeder zum Wandel beitragen. Eine bekannte Studie zu sozialen Kipppunkten zeigt verschiedene Dynamiken und Bereiche auf. Daraus lassen sich zusammenfassend unter anderem drei Faktoren ableiten, die gesellschaftliche Transformation beschleunigen können:
- Werte und Normen im Umfeld
- Bildung über Zusammenhänge,
- Transparenz über die Wirkungen von Maßnahmen.
Je mehr Menschen verstehen, warum Veränderung notwendig ist und welchen Sinn sie stiftet, desto größer wird die Unterstützung für nachhaltige Lösungen. Transformation ist möglich, wenn wir bereit sind, Paradigmen zu hinterfragen, Narrative zu verändern – und Wirkung konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Denn Wandel braucht beides: den Mut, Gewohntes zu hinterfragen – und die Fantasie, sich eine andere Zukunft vorzustellen.
Das macht Mut…
Mission Wertvoll hören und sehen
Warum gute Geschichten für die Transformation wichtig sind
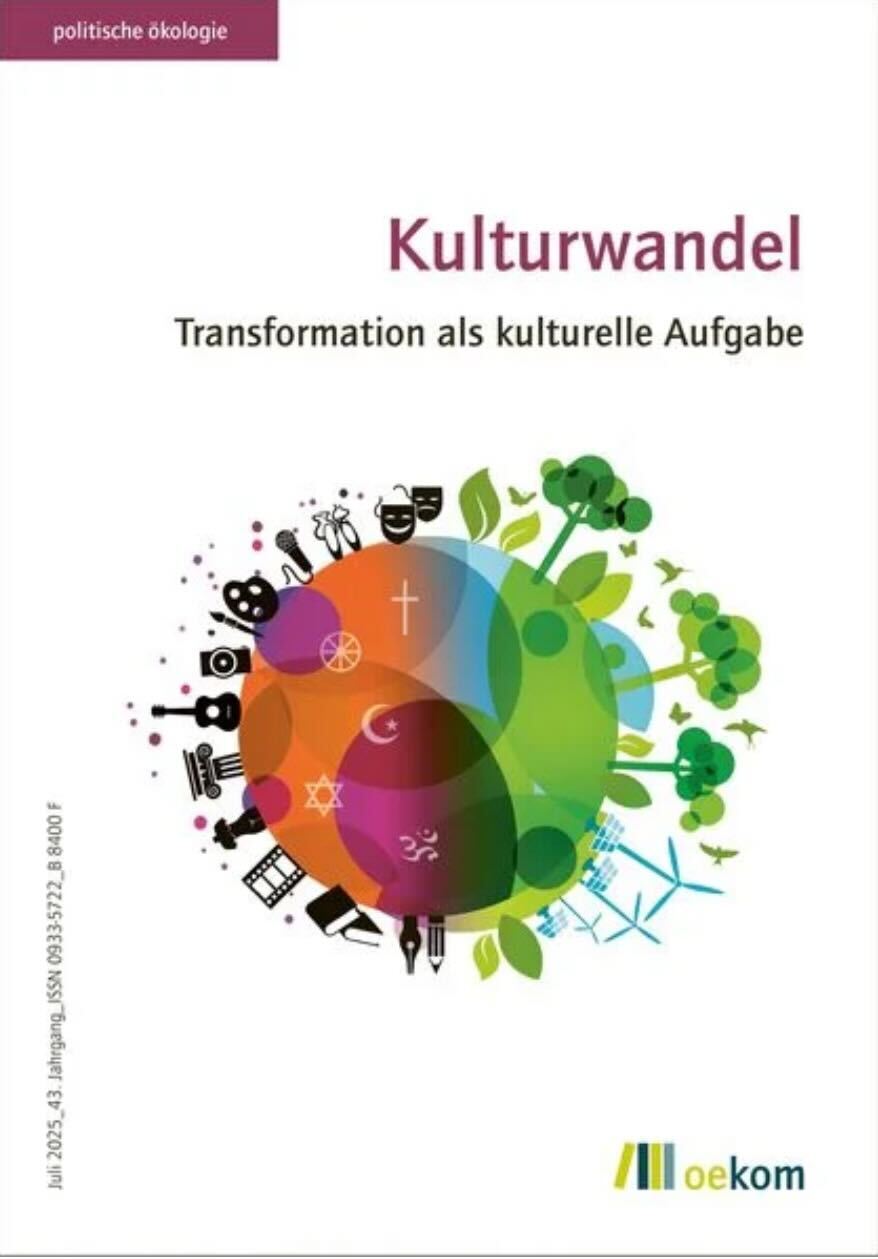
Screenshot: „Kulturwandel – Transformation als kulturelle Aufgabe“
In der Zeitschrift „Politische Ökonomie“ haben die Gründer von Planet Narratives darüber geschrieben, warum sich Fakten so gut über fiktive Geschichten transportieren lassen.